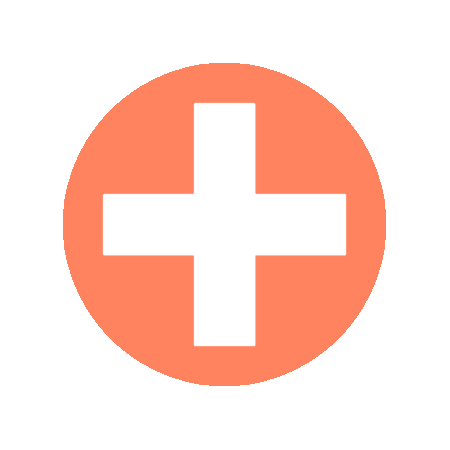Ansätze transformativer Gerechtigkeit zum Umgang mit zwischenmenschlicher Gewalt in Gemeinschaften (1): Die Kapitel mit kursiver Überschrift stammen aus einem zweiten Text mit dem Titel: Aussergerichtliche Perspektiven in Bezug auf sexuelle Übergriffe (2).
Als politisch aktive Feminist_inn_en haben wir uns in den letzten Jahren in verschiedenen emanzipatorischen Kontexten und Projekten bewegt, deren Selbstverständnisse beinhalteten, antisexistisch, queer_feministisch, selbstorganisiert, autonom, herrschaftskritisch, … zu sein. In Räumen, die Zufluchtsorte sind, gerade für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft Marginalisierung, Diskriminierung und Gewalt erlebt haben und erleben – FLINT Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, nicht binäre und Trans Personen, People of Color, Queers, Punks.
Aber auch solche emanzipatorische Räume sind nicht frei von zwischenmenschlicher Gewalt; auch hier setzen sich gesellschaftliche Herrschaftsmechanismen in Menschen und Strukturen fort. Dafür gibt es viele Beispiele: ungleich verteilte Arbeiten, Mackertum auf Aktionen, informelle Ausschlüsse sowie Ausschlüsse entlang von Machtgefällen, das Geschehen und die Toleranz von sexualisierten Übergriffen bis hin zum (oft jahrelangen) Schutz von gewaltausübenden Personen (3) in Polit-Strukturen. Zwischenmenschliche und gerade sexualisierte Gewalt bleiben also auch in „unseren“ Räumen eine Realität, zu der wir uns verhalten müssen. Oft provoziert dies vorstrukturierte Abläufe: Gewalt wird ignoriert, die Suche nach Umgängen verweigert und gewaltausübende Personen werden geschützt. Oder es herrscht Hilflosigkeit beim Versuch, mit Betroffenen umzugehen und Gewalt wird lediglich zurück gegen einzelne gewaltausübende Personen gerichtet, während die Strukturen der „Szene“ sowie der Gesellschaft, die zwischenmenschliche Gewalt ermöglichen, völlig unangetastet bleiben. Eine Ausprägung dessen ist der „Strafrechtsfeminismus“, das Hilfesuchen feministischer Akteur_inn_en beim Rechtsstaat – die Polizei rufen, Anzeige erstatten, vor Gericht gehen, etc. (4)
Recht schafft keine Heilung
Aber Recht schafft keine Gerechtigkeit, und schon gar keine Heilung von Gewalt Betroffener und ihrer Gemeinschaften. Stattdessen bearbeitet die Justiz Fälle von (sexualisierter) Gewalt nicht mehr als Konflikt der beteiligten Akteure und Akteurinnen, sondern als abstrakten Rechtskonflikt, vertreten durch die Staatsanwaltschaft, prüft einzig die Gegebenheit eines Straftatbestands, stellt dabei die „Glaubwürdigkeit“ einzelner Betroffener zur Disposition und erzwingt im Laufe des Strafprozesses immer wieder Konfrontationen mit dem Geschehenen. Zudem impliziert strafrechtsfeministisches Handeln, dass herrschaftliche Gewalt (…) akzeptiert und emanzipatorische Räume, die eben auch Schutzräume vor staatlichen Zugriffen sein sollen, für solche geöffnet werden. (…) Der Rechtsstaat ist selbst eine gewaltvolle, patriarchal-herrschaftliche Institution (…). Zur (Wieder-)Herstellung von Recht übt er wiederum Gewalt durch Strafe und einsperrende Institutionen aus. Wir sind überzeugt, dass der Rechtsstaat daher kein effizienter Partner im Kampf gegen (patriarchale) Gewalt sein kann. Die Straflogik zieht sich so tief durch die Gesellschaft, dass sich Strafdynamiken auch abseits des Staates manifestieren. Oft werden in Reaktion auf einzelne Fälle Formen von Ausschlüssen gewaltausübender Personen als einzige Option gesehen. Sicher können Ausschlüsse und z.B. die Aneignung konfrontativer Mittel gegen gewaltausübende Personen wirk- und heilsam sein. Wenn diese jedoch nicht von anderen Formen der Bearbeitung unterstützt werden, bringen sie keine tatsächliche Autonomie und (Wieder-)Aneignung von Handlungsmacht (agency), sondern verbleiben in Abhängigkeit von der/den gewaltausübenden Person/en.
Kurz gesagt: Wir erleben immer wieder Reaktionen auf Gewalt, die in Feuerwehrpolitik von Fall zu Fall arbeiten, ohne einen Schritt zurück zu machen, um Strukturprobleme zu betrachten und Umgänge auch für diese zu suchen; wir erleben Reaktionen mit der Fehlvorstellung, Strafe und Ausschlüsse würden Heilung versprechen, sowie – aus Hilflosigkeit oder autoritärem Strafbedürfnis – Rückgriffe auf Staat, Justiz und Polizei. All das passiert immer wieder, weil es an Strukturen fehlt, die alternative Erfahrungen zusammentragen und Handlungsmacht generieren, anbieten und teilen können. Dazu wiederum möchten wir solidarisch beitragen. An dieser Stelle fügen wir (die Archipel Redaktion) einen Ausschnitt aus einem anderen Text ein, der diese Fragen ausführlicher erörtert:
Ausschluss und Säuberung?
Und schliesslich stellt sich auch die Frage nach dem Ausschluss eines Täters: Wenn dies auch für die betroffene Person absolut notwendig sein mag, um wieder auf die Beine zu kommen, um keine Angst haben zu müssen, ihm an den Orten zu begegnen, die auch sie frequentiert, scheint uns dies nicht die einzige, zwangsläufig und systematisch anwendbare Lösung zu sein. Eines der Risiken, die sie birgt, besteht darin, den Eindruck zu erwecken, das Problem sei gelöst, sobald das schwarze Schaf beseitigt wurde. Mit den Autorinnen des leider nur französisch sprachigen Buches „Premiers pas sur une corde raide“ (Erste Schritte auf einem Drahtseil), möchten wir: „(...) die Illusion vermeiden, die Gemeinschaft könnte sich auf einer rettenden Säuberung wieder aufbauen. Die staatliche Justiz funktioniert zum Teil nach diesem Gebot, doch jeder weiss, dass sie nur ein System ist, das genau das reproduziert, was es zu bekämpfen vorgibt. Indem sie den Abweichler identifiziert, ihn ‚ausserhalb des Gesetzes‘ einschreibt, legitimiert sich die Gesellschaft, stärkt sich selbst und gibt sich ein gutes Gewissen. Der Rückgriff auf den exemplarischen Fall ermöglicht es all jenen, die nicht direkt von der Beschuldigung betroffen sind, sich von jedem Verdacht zu befreien, insbesondere durch die öffentliche Bekräftigung ihres Einverständnisses mit dieser Vorgangsweise. Die Wirksamkeit eines solchen Rückgriffs (recours) beruht weniger auf einer intimen und kollektiven Auseinandersetzung mit der Herrschaftslogik, die unsere Beziehungen beinflusst, als vielmehr auf der Furcht davor, selber belastet zu werden. Ein solches Vorgehen hat sich in der Vergangenheit sicherlich schon bewährt und kann auch zu Verhaltensänderungen führen. Wir zweifeln jedoch an der Möglichkeit, auf diese Weise ein Klima des Vertrauens herzustellen, das notwendig ist, um langfristig andere Beziehungen zu entwickeln. Genau an diesem Punkt zeigt sich die Komplexität des verworrenen Verhältnisses zwischen Freund_inn_en und Feind_inn_en, mit welcher der Feminismus ständig konfrontiert ist. Ein wirklicher Wandel wird nicht durch die Annahme eines tadellosen Verhaltenskodexes herbeigeführt werden, sondern durch eine immer wieder erneuerte Aufmerksamkeit für den/die Andere_n und für die Zeichen, die er/sie aussendet, auf den Kreislauf der Macht, auf die Komplexität und Tiefe der Beziehungen.“
Wir lehnen die Unschuld als Sichtweise ab, genauso wie die Idee der Säuberung eines Milieus. Die öffentlichen Denunzierungen haben es ermöglicht, freier über das Thema zu sprechen, aber sie haben auch bisweilen dazu gedient, Monster zu erschaffen, die bequem vorgeschoben werden können, um gleichzeitig die eigene Unschuld zu verkünden. Wir lehnen diese Denkweise ab, die uns glauben lassen möchte, dass es reicht, ein paar Abnorme zu beseitigen, um unsere Sicherheit zu wahren: Wir wissen nur zu gut, dass das Problem gerade in der „Normalität“ und ihren strukturellen Zusammenhängen liegt. Die Verwendung der monströsen Kategorie des Vergewaltigers dient manchmal dazu, eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen guten Männern, die sich nichts vorzuwerfen haben, und den anderen, gewalttätigen, den Vergewaltigern, denjenigen, die nicht das Konsens-Prinzip respektieren. Dabei ist die traurige Realität banal: Die meisten Übergriffe und Vergewaltigungen werden in erschreckend vertrauten Situationen begangen, sie haben ihren Ursprung in alltäglichen Herrschaftssystemen. Was wir hier sagen, soll weder diese Missbrauchssituationen banalisieren, noch denjenigen entlasten, der das Konsens-Prinzip missachtet, also die Grenzen einer anderen Person überschritten hat. Nicht Strukturen vergewaltigen, sondern Personen. Es bedeutet nur, dass das Denken in Kategorien wie „Monster“ uns nicht ermöglicht, angemessen über den strukturellen Charakter schlechter Beziehungen nachzudenken. Gerade weil die Beziehungen, die wir beschreiben, systemisch sind, glauben wir, dass die individuelle Emanzipation nicht ohne kollektive Emanzipation auskommen kann.
Essenzialisierung und Opfer-Diskurs
In der gegenwärtigen Debatte lehnen wir es ab, dass die Kategorien des Täters und des Opfers als nicht diskutierbare Identifikationspole fungieren. Innerhalb der verschiedenen feministischen Bewegungen verstehen wir uns als Teil eines Feminismus, der nicht voraussetzt, dass sich jede_r als Opfer versteht. Was uns interessiert, ist, gemeinsam gegen Repressionssysteme zu kämpfen, unsere Freiheitspraktiken zu stärken, und nicht in einer Kategorie eingesperrt zu sein, die Mitleid erregt. Wir verstehen, wie wichtig es sein kann, als Opfer von Aggression anerkannt zu werden, und wir sehen auch, inwiefern es wichtig sein kann, sich davon lösen zu können. Wir (dieses „wir“ bezieht sich auf uns Frauen, die diesen Text schreiben) wollen nicht darüber definiert werden, was wir erlitten haben, und noch weniger wollen wir, dass unsere Worte nur gehört werden, weil sie mit der Legitimität des Etiketts „Opfer“ geschmückt sind. Genauso lehnen wir es ab, jemandem lebenslang das Etikett des „Täters“ zuzuweisen: denn das hiesse, die Möglichkeiten einer radikalen Veränderung, an die wir glauben, zu leugnen. Ja, wir glauben, dass jemand, der die körperliche Selbstbestimmung einer anderen Person missachtet und deren Grenzen überschritten hat, dies erkennen, daran arbeiten, und sein Verhalten ändern kann. Es ist selbstverständlich, dass solche Prozesse langwierig und nicht immer erfolgreich sind, aber wir schliessen diese Möglichkeit nicht aus.
Wir versuchen nicht, unser Leiden zur Hauptantriebkraft unseres Kampfes zu machen, auch wenn es natürlich ein Teil davon ist. Vor allem lehnen wir die Perspektive ab, nach der eine kollektive Konstruktion unmöglich ist, angesichts eines „individuellen Gefühls“, das immer Recht haben wird, weil es leidet und als solches unzweifelhaft ist und zum herrschenden Argument wird. Wir sind umso misstrauischer dieser zeitgenössischen Subjektivierung gegenüber, als sie sich in den Glanzstunden des Neoliberalismus entfaltet.
Erprobte Methoden
Bereits in vorkolonialen Gemeinschaften gab es auf Heilung und Wiedergutmachung angelegte, dezentrale Umgänge mit Konflikten innerhalb von Gemeinschaften, z.B. Gacaca-Gerichte in Ruanda. Ende des 20. Jahrhunderts haben in den USA queere und feministische Communities of Color den Bedarf nach Konfliktlösung in ihren Gemeinschaften (…) mit Ideen basierend auf restorativer Konfliktlösung sowie radikalen und intersektionalen Analysen struktureller Machtverhältnisse verbunden und Konzepte „Transformativer Gerechtigkeit“ (TG) entwickelt. Beispiele dafür gibt es auch in den autonomen Gemeinschaften in Chiapas, in einigen kurdischen Gemeinschaften oder auch in den Armenvierteln von Chicago. Konkrete Vorschläge für die Entwicklung solcher Konzepte bieten beispielsweise die Gruppen INCITE!, CARA und Generation Five. INCITE!, ein Netzwerk radikaler Feminist_inn_en und Queers of Color, beschreibt vier Grundpfeiler solcher Gemeinschaftsprozesse: – Kollektive Unterstützung, Sicherheit und Selbstbestimmung für betroffene Personen; – Verantwortung und Verhaltensänderung der gewaltausübenden Person – Entwicklung der Community hin zu Werten und Praktiken, die gegen Gewalt und Unterdrückung gerichtet sind; – Strukturelle, politische Veränderungen der Bedingungen, die Gewalt ermöglichen. (…) „Transformative Gerechtigkeit“ (TG) ist dabei kein „Masterplan“, der im Fall einzelner Übergriffe angewandt werden kann. Im deutschsprachigen Raum existieren zudem verschiedenste Strukturen rund um Awareness-Arbeit, Praxen des Definitionsmacht-Konzepts, feministische Praxisliteratur, Organisierung zu Kritischen Männlichkeiten, immer wieder queer_feministische Aktionen und Interventionen. In TG sehen wir allerdings einen strukturellen Rahmen, der bestehende Arbeit um einige wichtige Handlungsfelder und Grundfragen ergänzt sowie einen Blick „über den Tellerrand“ ermöglicht – hin zu transformative(re)n Formen von Konfliktumgängen, Heilung, Wehrhaftigkeit und Resilienz. TG-Prozesse stellen hohe Ansprüche an Reflexion und gemeinschaftliche Arbeit und können scheitern, bedeuten aber für uns die Entscheidung (…) für Autonomie und Veränderung.
Workshopkollektiv ignite! *
- Das Workshopkollektiv ignite! ist ein herrschaftskritisches und horizontal organisiertes Kollektiv, das seit 2019 Workshops anbietet und auch eigene Texte veröffentlicht. Aktuell bietet die Initiative u. a. Workshops zu Transformativer Gerechtigkeit, Sicherheitskultur, Gender, Antisexismus und Sexualität_en an. Alle Infos unter ignite.blackblogs.org.
- Wir fanden diesen Text auf Barrikade.info; erstveröffentlicht wurde er auf femref.uni-oldenburg.de (Anm. d. Archipel-Redaktion)
- Der Text „Aussergerichtliche Perspektiven in Bezug auf sexuelle Übergriffe“ wurde vom Solidaritätsfonds von Lyon im Anschluss an Debatten verfasst, die seit November 2019 von mehreren politisch engagierten Kollektiven zur Frage der Bewältigung sexueller Übergriffe animiert wurden.
- In Abgrenzung z.B. zur staatlichen und medialen Markierung von „Täter“ und „Opfer“ bzw. „Geschädigte_r“, die jeweils stigmatisierende und dauerhafte Identitäten zuschreiben, verwenden wir hier die Begriffe „gewaltausübende“ und „betroffene“ Person.
- vgl. Limo Sanz, „Strafrechtsfeminismus und Queere Straflust“, Transformative Justice Kollektiv Berlin, in: „Was macht uns wirklich sicher?“ Toolkit für Aktivist_inne_n.