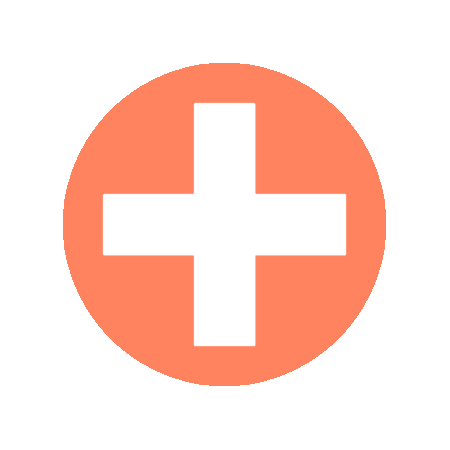Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ist eine Argumentation weit verbreitet, laut der sich die Linke in den letzten Jahren nur auf die Anliegen von Minderheiten konzentriert habe. Soziale Ungleichheit und deren Bekämpfung sei aus dem Blick geraten. Kurz: Identitätspolitik habe den Klassenkampf abgelöst. Diese Entwicklung habe schliesslich auch den Aufstieg der Ultrarechten beflügelt, wenn nicht sogar ausgelöst.
Diese Kritik kommt aus unterschiedlichen politischen Lagern: Der rechtsliberale Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der mit seiner These vom «Ende der Geschichte» in den 1990er Jahren für einiges Aufsehen gesorgt hatte, vertritt sie in seinem Buch Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet (2018). Aber auch Leute wie der Showmaster Bill Maher, die Philosophin Nancy Fraser und der Soziologe Zygmunt Bauman haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder dieser Argumentationsfigur bedient. Linke Politik solle sich, fordert etwa auch der Politologe Mark Lilla, Autor des vielbeachteten Buches The Once and Future Liberal: After Identity Politics (2017), wieder Anliegen widmen, die «einem Grossteil der Bevölkerung am Herzen liegen». Denn diese Themen würden nun von den Rechten besetzt, was sich bitter gerächt hätte. Auch im deutschsprachigen Raum mehren sich die Stimmen, die behaupten, die Auseinandersetzung um Identitätspolitiken – also etwa das Eintreten für Feminismus, Homosexuellenrechte, «Black Lives Matter» – hätte die Beschäftigung mit Ausbeutung und sozialer Ungleichheit ersetzt. Doch zum Proletariat, das mit der Wahl Donald Trumps angeblich Rache übte, gehört nicht nur der weisse Rust-Belt-Arbeiter, sondern auch die afroamerikanische Uber-Fahrerin, die lateinamerikanische Pflegerin sowie die Asian American im Call-Center. Angesichts des immer noch gewaltigen «Gender und Racial Pay Gap» müssten beispielsweise Afroamerikanerinnen eigentlich sogar die allerersten Adressatinnen für rechtspopulistische Arbeitskampfrhetorik sein. Doch die von Trump hat bei ihnen nicht verfangen, 94 Prozent der schwarzen Frauen wählten Hillary Clinton. «Niemand vermochte je zu begründen, warum gerade jene, die die New Economy am gründlichsten abgehängt hatte – nämlich die schwarze und die hispanischstämmige Arbeiterschaft –, sich nie zu Trumps Anhängern gesellten», schreibt Ta-Nehisi Coates an die Kritiker·innen der Identitätspolitik. Der Gegensatz von Identitätspolitik und Klassenkampf ist also falsch. Er verkürzt nicht nur die komplexen politischen Verschiebungen der Gegenwart auf eine einfache Formel, sondern er lässt sich auch historisch nicht halten.
Der Vorwurf ist nicht neu
Die Kritik an der Identitätspolitik ist letztlich so alt wie die linke Identitätspolitik selbst. Am berühmten «Hauptwiderspruch», also der kapitalistischen Ausbeutung, mit dessen Beseitigung sich auch alle anderen Unterdrückungsformen ganz von selbst in Wohlgefallen auflösen würden, arbeitet sich insbesondere die feministische Kritik schliesslich seit bald 150 Jahren ab. Doch bei dieser ausschliessenden Gegenüberstellung des Kampfes um soziale Anerkennung versus des Kampfes gegen soziale Ungleichheit werden die vielen – praktischen wie theoretischen – Verknüpfungen von Politiken der Anerkennung kultureller Differenzen mit jenen gegen soziale Ungleichheit übersehen: Die US-Bürger·innenrechtsbewegung in den 1960er-Jahren richtete sich gegen Armut ebenso wie gegen Rassismus, die feministische 1970er-Jahre-Forderung nach Lohn für Hausarbeit verknüpfte Anerkennungs- und Umverteilungsanliegen, seit den 1990er-Jahren treten indigen geprägte Bewegungen in Lateinamerika gleichermassen für die Anerkennung «traditionellen Wissens» und für ein «gutes Leben» (buen vivir) für alle ein. Die Beispiele liessen sich fortsetzen. Mit dem Vorwurf, die Identitätspolitiken hätten die Thematisierung von Klassengesellschaft und Ausbeutung verdrängt, wird darüber hinaus so getan, als ginge es bei Identitätspolitiken nicht auch um ernsthafte linke Anliegen wie Gleichberechtigung, Partizipation, Umverteilung und Befreiung. Identitätspolitik ist ja immer die Reaktion auf einen spezifischen Ausschluss: Frauen gehen in der Kategorie Klasse nicht auf, Women of Colour haben andere Diskriminierungserfahrungen als weisse Frauen und so weiter. Insofern ist linke Identitätspolitik eine Inklusionspolitik. Sie zielt darauf ab, möglichst viele Unterdrückungsformen zu fassen. Sie tut dies überdies nicht aus purer Freude an der Differenz. Schliesslich sind kollektive Identitäten immer Konstruktionen: Sie entstehen aus Selbstzuschreibungen wie auch aus den Zuschreibungen durch andere. Diesen Benennungen von aussen lässt sich nicht leicht entfliehen: Wer als Frau ausgegrenzt oder als Schwarze diskriminiert wird, kann eben nicht einfach sagen, dieser Kategorie fühle ich mich gar nicht zugehörig. Diskriminierung und Exklusion verlaufen immer über kollektive Kategorien. Daher muss auch der Kampf gegen sie sich manchmal wohl oder übel auf diese Kategorien beziehen. Identitätspolitik ist in diesem Sinne eine notwendige Strategie.
Identitätspolitik der Arbeiter·innenbewegung
Diese Strategie ist übrigens keineswegs nur von Frauen oder ethnischen Minderheiten angewandt worden. Auch die Arbeiter·innenbewegung, also die wichtigste Akteurin im Kampf gegen soziale Ungleichheit, war eindeutig eine identitätspolitische Bewegung. Schliesslich sind all jene praktischen wie theoretischen Versuche, unter den Lohnabhängigen (und über sie hinaus) ein Klassenbewusstsein zu formieren, Formen von Identitätspolitik: Auch hier ging es nicht zuletzt darum, dass die Einzelnen sich kollektiv über die Arbeit und über ihre Klassenposition identifizierten. Gemeinsamkeiten sollten betont, Ähnlichkeiten – Identität kommt vom Lateinischen idem, das heisst gleiches, dasselbe – hervorgehoben werden. Von Lenin über Georg Lukács, von Rosa Luxemburg zu Antonio Gramcsi sind die Texte der Theoretiker·in-nen der Arbeiter·innenbewegung voll von Gedanken darüber, wie ein kollektives Bewusstsein über die Gemeinsamkeiten der Klasse hergestellt werden könnte und sollte. Diese Gemeinsamkeiten waren zudem nicht bloss Kopfsache: Es ging nicht allein ums Klassenbewusstsein, sondern auch um die alltägliche Praxis. Menschen fühlten sich als Teil einer Gruppe – und wurden von anderen so wahrgenommen –, weil sie Kneipenbesuche und Mitgliedschaften in Sportvereinen, Waschküchen und Hinterhöfe miteinander teilten. Linke Identitätspolitik gibt es also nicht erst seit den 1960er oder gar den 1990er-Jahren und sie ist auch nicht auf ethnische, geschlechtliche und sexuelle Minderheiten beschränkt.
Überkreuzungen von Unterdrückung
Die linken Identitätspolitiken der 1960er Jahre entstanden schliesslich aus den Erfahrungen verschiedener Menschen, in den wichtigsten Kategorien – allen voran jener der Arbeiterklasse – nicht vorzukommen. Übersehene und ausgegrenzte Erfahrungen von Diskriminierung und Ausbeutung sollten benannt und sichtbar gemacht werden. Auch solche Kämpfe gab es schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere von Seiten der Frauenbewegungen. In den 1970er-Jahren gewannen sie erneut an Schärfe. Und es kam die Einsicht auf, dass sich die verschiedenen Unterdrückungserfahrungen durch die patriarchale Ordnung, durch die Ausbeutung der Klassensubjekte und die Ausgrenzung und Diskriminierung ethnischer Minderheiten gegenseitig durchkreuzen. Nach diesen Überkreuzungen mussten sich schliesslich auch die Kämpfe ausrichten. Das Combahee River Collective, eine Gruppe Schwarzer lesbischer Frauen, formulierte es in einem Text von 1977 so: «Gemeinsam mit Schwarzen Männern kämpfen wir gegen Rassismus, während wir gleichzeitig wegen Sexismus gegen Schwarze Männer kämpfen.» Als Proletarierinnen und Lesben kämen für sie aber noch weitere Marginalisierungserfahrungen hinzu. Die einzelnen Kämpfe liessen sich kaum voneinander trennen: «Wir finden es oft schwer, rassistische, klassistische und sexistische Unterdrückung zu unterscheiden, weil wir sie in unseren Leben oft gleichzeitig erleben.» An diesem Gedanken gilt es auch heute wieder anzuknüpfen. Er zielt auf Erweiterung der Perspektiven und auf Inklusion bislang Ausgegrenzter, nicht auf Segregation. Die vielstimmige Anklage gegen die vermeintliche Schwächung der Linken durch Identitätspolitiken blendet diese Geschichte völlig aus. Und auch im Hinblick auf die Gegenwart ist sie falsch: Ob nun in der SPÖ oder bei Labour oder der brasilianischen PT – wenn innerhalb der parlamentarischen Linken die soziale Frage vernachlässigt wurde, dann aufgrund neoliberaler Paradigmenwechsel und keineswegs deshalb, weil sie durch die identitätspolitischen Scharmützel von Splittergruppen ersetzt worden wäre. Für das 9,6-Prozent-Debakel der SPD bei der letzten Wahl in Bayern ist also die Debatte zum vielgescholtenen Transgenderklo definitiv nicht verantwortlich.
Problematische Identitätspolitiken
Sicherlich ist nicht jede Identitätspolitik von links per se emanzipatorisch. Sie ist es vor allem dann nicht, wenn sie zur inhaltsleeren, essentialisierenden Repräsentationspolitik verkommt. Wenn also die Legitimität einer Aussage sich nicht mehr am Argument und der Positionierung misst, sondern an Hautfarbe oder vermeintlich feststehender Gruppenzugehörigkeit. Problematisch ist Identitätspolitik auch dann, wenn sie als Immunisierungsstrategie gegen Kritik missbraucht wird, wenn also jede Kritik etwa an der antisemitischen Nation of Islam als Rassismus gegenüber Schwarzen abgeblockt wird. Genauso wenig soll geleugnet werden, dass identitätspolitische Kleinkriege schon viel Kraft und Geschlossenheit gekostet haben und sie sich mitunter auch in eitlen Distinktionskämpfen erschöpfen. Aber unter dem Strich bildet die identitätspolitische Kritik von Minderheiten dennoch gerade die Stärke und eben nicht die Schwäche linker Bewegungen. Denn sie will Marginalisierungen überwinden und Minderheitenpositionen integrieren, um so gemeinsam für grössere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Die identitätspolitische Kritik an gesellschaftlichen Ausschlüssen und Asymmetrien ist mitnichten bloss eine Schwäche, die zu Fragmentierungen und Zerwürfnissen führt, sondern sie ist auf lange Sicht gerade die Stärke linker Bewegungen. Nicht Spaltung ist also das Ziel, sondern vielmehr das, was vermeintlich verhindert wird: Solidarität.
Lea Susemichel hat Philosophie und Gender Studies studiert und ist Redakteurin bei an.schläge. Das feministische Magazin. Zusammen mit Jens Kastner veröffentlichte sie: Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken, Unrast Verlag, Münster, 150 S., 12,80 Euro.
Jens Kastner ist Soziologe und Kunsthistoriker und unterrichtet an der Akademie der bildenden Künste Wien.
Erstveröffentlicht am 23. Januar 2019 in dem antifaschistischen Magazin LOTTA, Ausgabe 73. http://www.lotta-magazin.de LOTTA – antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen erscheint 4x im Jahr und ist über 60 Seiten dick! Sie können das Magazin für nur 19 Euro/Jahr abonnieren bei: lotta-vertrieb@nadir.org